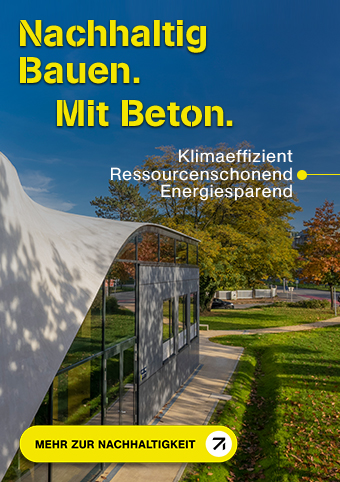Beton- und Bautechnik
Beton wird oft als „Baustoff des 20. Jahrhunderts“ bezeichnet – dass er auch das Potenzial zum Baustoff des 21. Jahrhunderts hat, beweisen zahlreiche betontechnologische Innovationen. Die Zeiten, als Beton noch ein einfaches 3-Stoff-Gemisch aus Zement, Wasser und Zuschlag war, sind vorbei - High-Tech-Beton ist heute ein 6-Stoff-System aus Zement, Gesteinskörnung, Wasser, Zusatzmittel, Zusatzstoffen und Luft.
Durch intelligentes Variieren und Modifizieren dieser Bestandteile kann Beton ganz neue Verarbeitungs- und Nutzungseigenschaften gewinnen – als Beton, der nicht mehr durch Rütteln verdichtet werden muss (SVB), als hochfester oder ultrahochfester Beton, als säureresistentes Baumaterial, als Faserbeton mit Zusatz von Stahl- oder Glasfasern, als Leichtbeton oder selbstreinigender Beton.

Diese Rubrik gibt einen Überblick über wichtige Entwicklungen in dieser Richtung und informiert außerdem über grundlegende praxisrelevante Themen wie Bauphysik, fachmännische Ausführung von Sichtbeton oder weißen Wannen sowie die Auswahl des Betons im Rahmen der aktuellen Normung.