
15.09.2025
Nachhaltige Zemente
Für die Energieinfrastruktur

Betonage eines Plattenfundaments (Foto: Dyckerhoff)
Nachhaltige Zemente für den Ausbau der Energieinfrastruktur – Erfolgreiches Pilotprojekt zum Einsatz von klinkereffizientem Zement Dyckerhoff CEDUR
Der für die Erreichung der gesetzlich vorgeschriebenen CO2-Minderungssziele im Energiesektor notwendige umfangreiche Ausbau erneuerbarer Energien, wie z.B. der Windenergie, erfordert gleichwohl enorme Investitionen in die entsprechende Strominfrastruktur. Vor allem für die Fundamente, die Strommasten von Hochspannungsleitungen und Windenergieanlagen sicher tragen müssen, wird Beton benötigt. Das Fundament eines Strommastes besteht je nach Größe und Bodenbeschaffenheit aus rund 200 m³ Beton, entsprechend sind gut 70 t Zement darin enthalten.
Der größte Anteil der CO2-Emissionen des Betons entfällt auf den Zement. Durch Verwendung von Zementen mit mehreren Hauptbestandteilen können die CO2-Emissionen im Beton jedoch reduziert werden. Eigentlich ist das nichts Neues. Die Herstellung und Verwendung von Zementen mit mehreren Hauptbestandteilen, wie beispielsweise Portlandkalkstein-, Portlandhütten- oder Portlandkompositzementen mit relativ hohen Anteilen an Kalksteinmehl, Hüttensand oder Flugasche sind in Deutschland schon lange Stand der Technik. Jedoch ist davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren die Verfügbarkeit von Hüttensanden und Flugaschen in Westeuropa abnehmen wird. Vor diesem Hintergrund wurden neue Kompositzemente entwickelt und eingeführt. Für die Dyckerhoff Standorte Amöneburg, Neuwied sowie Lengerich – und zukünftig außerdem Göllheim – ist das der CEM II/C-M (S-LL) 42,5 N mit dem Markennamen CEDUR. Dieser Zement ist seit Ende 2020 überwiegend in Betonen bis zu einer Festigkeitsklasse C25/30 im Einsatz und sein Marktanteil im Transportbetonsegment wächst stetig.
Mit dem Ziel, unnötige Emissionen zu vermeiden, haben auch Trassenbetreiber und Hersteller von Windenergieanlagen begonnen, Betone mit geringerem CO2-Fußabdruck einzusetzen. Um den Anwendungsbereich von CEDUR zu erweitern, wurden im Betonlabor des Wilhelm Dyckerhoff Instituts (WDI) Einsatzmöglichkeiten in höherwertigen Betonen, z.B. mit Frost-Tausalz-Beaufschlagung, sowie in Betonen mit höheren Festigkeitsklassen von C30/37 bis C40/50 und höher untersucht, wie sie z.B. beim Bau von Windenergieanlagen zum Einsatz kommen. Die Laborversuche verliefen positiv. Eine entsprechende Praxisanwendung fehlte jedoch vorerst noch.
Im Frühjahr 2024 war es dann so weit: Im Rahmen des Neubaus der 380-kV-Leitung zwischen Stade und Landesbergen beabsichtigte der Übertragungsnetzbetreiber TenneT Germany, CO2-optimierte Betone zu testen. Ziel war es, zu bewerten, ob und ggf. unter welchen Auflagen oder Einschränkungen ein Rollout auf zukünftige Freileitungsbauprojekte sowohl technisch realisierbar als auch ökonomisch effizient ist.
In Zusammenarbeit mit unserem Kunden Tramira wurden die im Labor entwickelten Betone an die Bedürfnisse des Auftraggebers angepasst. Gegenstand des Projekts waren sowohl Verankerungen mittels Bohrpfählen als auch Flachgründungen für Strommasten, für die jeweils ein Beton mit der Festigkeitsklasse C30/37 bzw. C35/45 geplant war. Insgesamt sollten hierbei Verbesserungen des CO2-Fußabdrucks um 30% erreicht werden, ohne jedoch den Bauprozess, z.B. infolge einer langsameren Festigkeitsentwicklung, zu beeinträchtigen. Ferner bestand das Ziel, möglichst mit lokal verfügbaren Rohstoffen zu arbeiten. Alle diese Kriterien erfüllte der Beton auf Basis des CEDUR aus dem Werk Lengerich.
Die Betonzusammensetzungen wurden in enger Abstimmung mit dem Betonhersteller Tramira festgelegt, wobei die Betone sowohl für die in diesem Projekt gestellten Anforderungen, aber auch für die Errichtung von Fundamenten für Windenergieanlagen entworfen wurden.
Im Fokus der Untersuchungen im Rahmen des Projekts standen nach statischer Auslegung zwei Anwendungsfälle von Betonfundamenten: Flachgründungen und Pfahlgründungen. Baubegleitend wurde eine Vielzahl von Betonkennwerten sowohl im Betonwerk als auch auf der Baustelle ermittelt. Dabei ging es vor allem um die Entwicklung der Festigkeiten der Betone in Abhängigkeit von den unterschiedlichen Witterungsbedingungen sowie den Nachweis, dass die Verwendung klinkereffizienter Zemente auch in höherwertigen Betonanwendungen möglich ist. Neben den obligatorischen Qualitätsprüfungen im Betonwerk und auf der Baustelle diente ebenso eine Vielzahl von im Freien gelagerten Erhärtungswürfeln dem kontinuierlichen Monitoring des Baustoffs.
Die Betonagen erfolgten zwischen Februar und Juli 2024, wodurch unterschiedliche Witterungseinflüsse berücksichtigt werden konnten. Das Pilotprojekt sowie die weiteren Untersuchungen zeigten, dass die eingesetzten CO2-optimierten Betone auf Basis des klinkereffizienten CEM II/C-M (S-LL) 42,5 N (na)-Zements auch für hochwertige Anwendungen, wie in diesem Fall Bohrpfahlbetone und Betone für Plattenfundamente für Strommasten, gut geeignet sind.
Nach eigenen Aussagen hat die Minimierung der CO2-Emissionen beim Auf- und Umbau des Energiesystems für den Netzbetreiber TenneT Germany eine hohe Bedeutung. Die in diesem Projekt gewonnenen Ergebnisse zeigen, dass es möglich ist, die Ziele Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz des Auftraggebers in Einklang zu bringen.
Weitere Informationen sind dem Sonderdruck des im April 2025 in der Fachzeitschrift beton veröffentlichten Artikels Nachhaltige Betone für die Energiewende unter www.dyckerhoff.com/pressemitteilungen zu entnehmen. Dieser ist in Zusammenarbeit mit Tramira Transportbetonwerk Minden-Ravensberg und TenneT Germany entstanden.
Quelle: Dyckerhoff GmbH




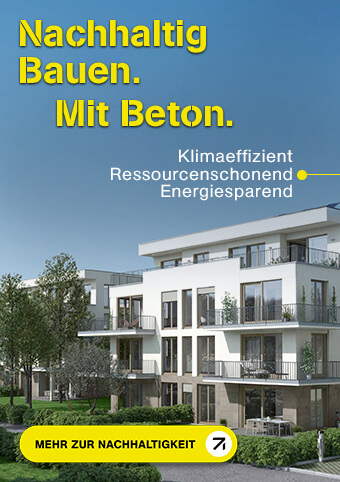
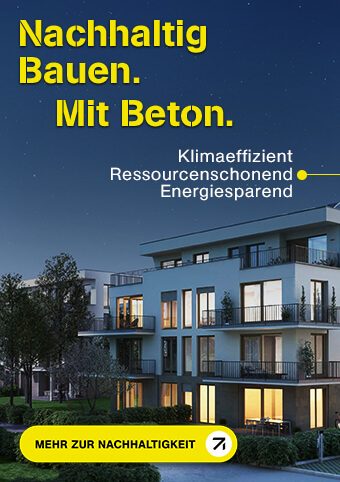

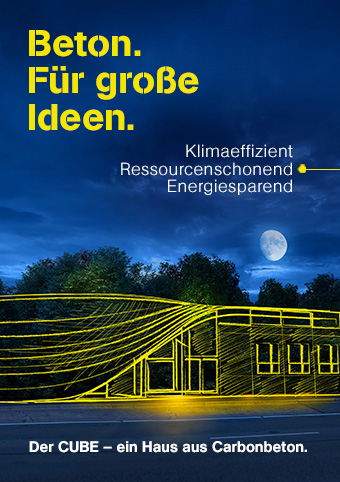
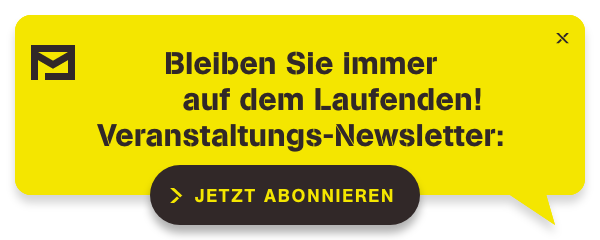

Social Stream
Instagram
Linkedin
Youtube
Folgen Sie uns auf: